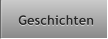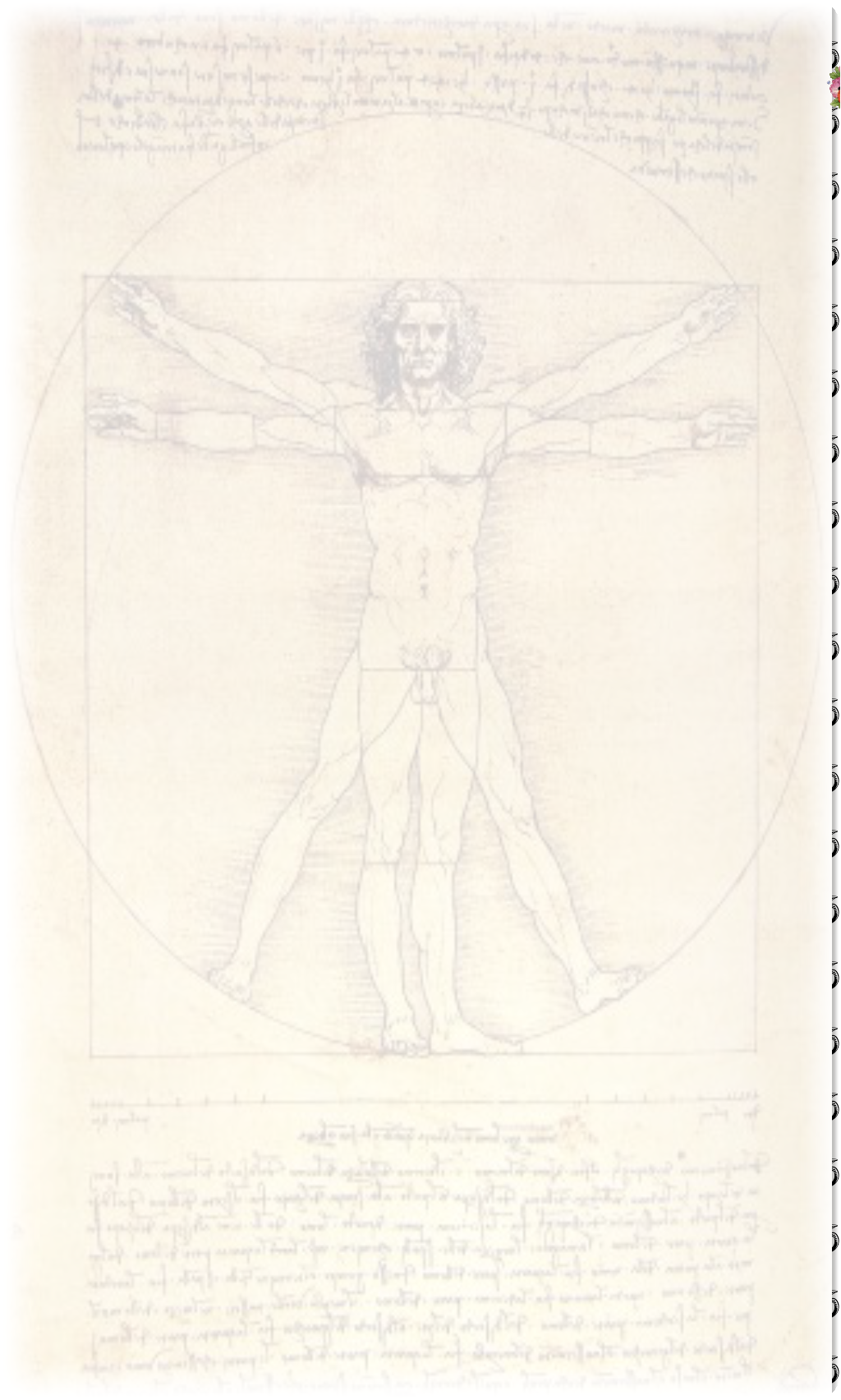





zurückblättern
weiterblättern
zurück zum Anfang/Inhalt des Tagebuchs

Mein Körper hatte sich verändert. Ich sah nun aus wie ein Preisboxer. Die
Wassereinlagerungen hatten Arme und Beine massiv aufgequollen. Mein
linker Arm wurde mit einer Elastikbinde eingewickelt, was tatsächlich
schnell Wirkung zeigte. Die Beine aber wurden schwerer und schwerer.
Von einem Stuhl aufstehen war ohne Hilfe zur Unmöglichkeit geworden.
Das selbe galt für die Toilette, was sich nun als größtes Problem darstellte.
Eine Sitzerhöhung konnte hier Abhilfe schaffen.
Plötzlich stand das Wort „Reha“ im Raum. Man wollte mir unbedingt eine medizinische Rehabilitation
angedeihen lassen, drängte es mir regelrecht auf. Ärzte und Schwestern redeten davon und priesen die Vorteile
an. Sie alle schienen kein schönes Zuhause zu haben und froh zu sein, kämen sie einmal an einen anderen Ort mit
Luftveränderung und Aussicht auf einen Kurschatten. Ja, diese russische Ärztin war sehr nett und freundlich, aber
warum wollte sie mich mit einer solchen Maßnahme unbedingt bestrafen? Fremde Menschen, fremde Umgebung,
fremder Rhythmus, ich besaß nicht einmal einen Trainingsanzug und womöglich musste ich da sogar Fahrrad
fahren…. Niemals!
An einem Sonntagmorgen, kurz vor 6.00 Uhr flog die Tür auf. In meinem Kämmerchen stand eine alte Oma im
Morgenmantel. Ich war aus tiefstem Schlaf gerissen worden und starrte die zerzauste Erscheinung erschrocken
an.
„Guten Tach! Ich wollte dich mal besuchen kommen. Ist der Daniel bei Dir?“ Wütend hob ich meine Decke, so
dass sie auch drunter schauen konnte. „Nein, hier ist niemand weiter.“ Da drehte sich die Oma schwungvoll um
und verließ mein Kabüffchen.
Die nette Physiotherapeutin war auch nicht mehr da. Es kam eine andere Frau, die mir unbedingt einen Rollator
aufschwatzen wollte. Sie hatte eine Augenfehlstellung, und je intensiver sie mich anschaute, desto weiter ging ihr
Blick daneben, so dass ich völlig irritiert nach einem Bezugspunkt in ihrem Gesicht suchte. Sollte ich mich nun
auf das Gesagte konzentrieren oder auf ihren Blick? Beides zusammen war schwierig. Zum Glück hatte auch sie
einen Schüler dabei, der sich um den sportlichen Teil kümmerte. Dieser junge Mann wirkte so sympathisch und
kompetent, dass ich tatsächlich das Gefühl bekam, mit seiner Hilfe bald wieder richtig gesund zu sein. Er
motivierte mich und meinte fröhlich:
“Das kriegen wir schon hin. Am Ende wandern Sie im Handstand aus dem Krankenhaus.“
Ich glaube, hätte er mich bis zum Ende meines Krankenhausaufenthaltes weiter begleitet, ginge es mir heute
tatsächlich weit besser. Stattdessen schickte man mir schon 3 Tage später einen anderen Schüler. Auch er war nett
und gab sich große Mühe. Ihm fehlte aber noch Kompetenz und das gewisse Gefühl im Umgang mit Patienten.
Auf Anordnung seiner Lehrerin kam er mit einem Rollator. Und was für einem! Er war groß und massig mit
breiten Schalen für die Arme, so dass man beim Gehen fast liegen konnte. Das muss wohl der Rolls Royce unter
den Rollatoren gewesen sein. Ich hatte sowas noch nie gesehen. Also trabte ich mit dem Teil zweimal den langen
Gang rauf und runter, was keinerlei Schwierigkeit darstellte. Das Ding machte es mir einfach zu leicht. Sogar ein
Laie wie ich weiß, ein Rollator ist bei einem Krankheitsbild wie meinem kein wirklich geeignetes Hilfsmittel.
In einem Krankenhaus geht es immer hektisch zu. Ständig kam irgendwer und wollte irgendwas. Da genoss ich
die Ruhe ohne Fernseher, auch wenn das mein Mann gar nicht verstehen konnte. Ich war einziger Patient im
Zimmer und das störte mich überhaupt nicht. Gern hätte ich geschrieben, schon in den ersten Tagen mit einem
Krankenhaustagebuch begonnen. Wenn man jedoch ständig an irgendwelche Geräte angeschlossen ist und
laufend gestört wird, ist das schwierig. Krankenhaus ist Stress. So sitzt man z.B. nichtsahnend auf der Toilette, als
eine Schwester reingestürzt kommt, um mal eben den Blutzucker zu messen. Überhaupt hatte ich ausgerechnet
auf der Toilette noch einige Erlebnisse, die da eigentlich so gar nicht hingehören. Ich beobachtete mich selbst und
erkannte, wie ich mich veränderte. Immer auffälliger wurde die Ähnlichkeit mit meinem Vater. Ich ertappte mich
dabei, dass ich mich ähnlich träge und langsam bewegte wie er. Auch er ließ damals alles klaglos über sich
ergehen. Vor allem aber war ich die mit dem Verstand meiner Mutter und den Bewegungen meines Vaters.
Zu den angenehmen Begegnungen gehörte ein Seelsorger, ein junger Mann aus dem Erzgebirge. Ich weiß gar
nicht, ob er katholisch oder evangelisch war. Mit Kirche habe ich ja eigentlich gar nichts im Sinn. Mit ihm
unterhielt ich mich aber ausführlich. Es herrschte eine heitere Stimmung und war eine schöne Abwechslung. Mit
ihm sprach ich auch über die Mutmaßungen zu meiner angeblichen Depression. Inzwischen wusste ich, wie es
dazu gekommen war. Diese polnische Ärztin in meinem Schlafzimmer sprach auch mit meinem Mann, der
übereifrig aus seiner Sicht über meine Motive nicht zum Arzt zu gehen plapperte, und diese Frau hat das auf ihre
Weise interpretiert. So kann es gehen, wenn zwei Menschen meinen, nun genau zu wissen, wie eine dritte Person
tickt.
Gern erinnere ich mich an einen Pfleger, der nur aushilfsweise auf dieser Station tätig war. Stockschwul, aber so
ein lieber Kerl von erfrischender Jugend, dass ich gern an diese Gespräche zurückdenke. Ach, und dann war da
noch diese kleine dicke Schwester, die von sich sagte, sie sei immer zärtlich. Das wirkte stets etwas befremdlich,
aber ich musste lachen. Sie konnte eben besonders gut Spritzen setzen. Auffällig war auch Samson. So nannte ich
ihn in meinen Gedanken. Das war ein sehr großer, schwergewichtiger Pfleger mit einem sanften Gemüt. Die
Schwester mit dem Schildchen, auf dem ein Bild von Bibi Blocksberg prangte, hatte äußerlich tatsächlich
Ähnlichkeit mit dem Hexlein. Sie war eine der Wenigen, die glaubhaft schilderte, der Beruf einer
Krankenschwester sei für sie eine Berufung.