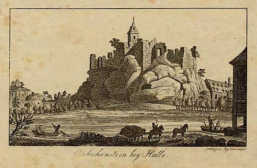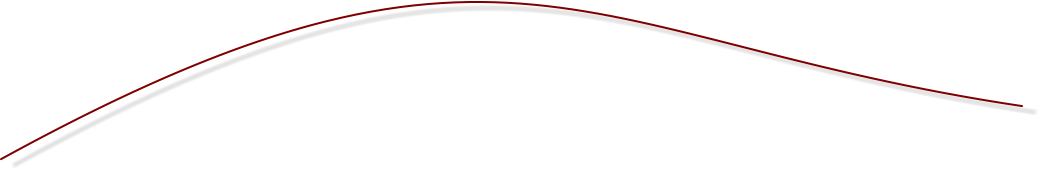
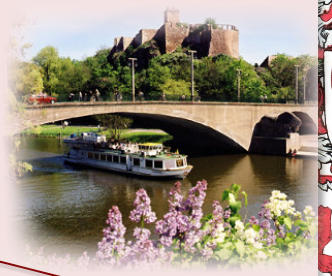

© Stadt Halle (Saale)


zuletzt aktualisiert 2020










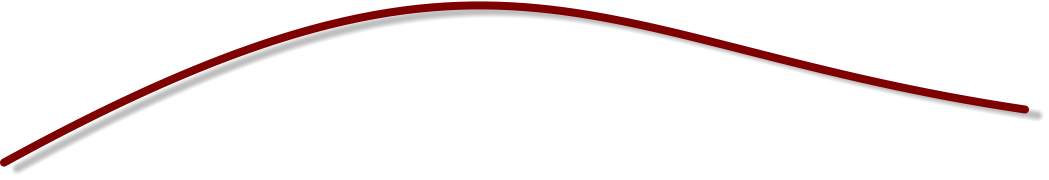


In der nördlichen Burgstraße finden wir
vor allem alte Wohnhäuser und
Kneipen. Letztere sind beliebte
Treffpunkte der Burgstudenten. Das
Eckgebäude ganz am Ende der Straße
ist der Gasthof „Mohr“. Es ist das
älteste noch in Betrieb befindliche Wirtshaus der Stadt. Die
Ausstattung der Gasträume ist vielfach noch im Originalzustand,
was eine sehr gemütliche
Atmosphäre garantiert. Direkt
vor uns sehen wir die alten
Mauern der Burg
Giebichenstein. Sie ist die 2.
Sehenswürdigkeit Halles auf
der Straße der Romanik.



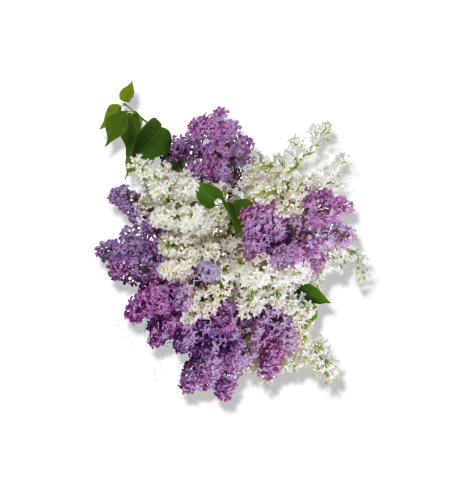


„Da steht eine Burg überm Tale….“ stellte bereits
ganz verzückt der Romantiker Freiherr Joseph von
Eichendorff fest und meinte die Burg
Giebichenstein am rechten Saaleufer, hoch oben auf
einem Porphyrfelsen. Die Burg ist nun etwa 1000
Jahre alt, doch deutet alles darauf hin, dass zuvor an
gleicher Stelle bereits eine Kultstätte der Germanen
gelegen haben muss. Die Geschichte unserer Burg beginnt im 10.
Jahrhundert. Der erste deutsche König Heinrich ließ eine Grenzfeste
errichten, um sich gegen die Ungarnheere zu schützen. Die ersten
urkundlichen Erwähnungen gab es 921. König Otto I. (später Kaiser
Otto) schenkte die Burg samt der Siedlung zu ihren Füßen dem
Moritzkloster zu Magdeburg, aus dem später das Erzbistum Magdeburg hervorging. So kam es, dass lange
das Jahr 961 auch als Gründungsjahr der Stadt Halle galt und wir bereits 1961 eine große Tausendjahrfeier
hatten. Unter Erzbischof Wichmann (1152-1192) erlebte die Burg ihre Blütezeit. Der weltoffene Kirchenfürst
hielt glanzvoll Hof. So weilten viele deutsche Fürsten, Dichter und Sänger auf der Burg. Auch seine
Nachfolger hielten es so, aber trotz allem war die Burg auch immer Gefängnis. Die Sage von Ludwig dem
Springer ist noch heute wohlbekannt. Während des dreißigjährigen Krieges wurde die Giebichenstein durch
schwedische Truppen verwüstet und niedergebrannt. Während die Unterburg bald wieder aufgebaut und als
bäuerlicher Betrieb genutzt wurde, blieb die Oberburg Ruine. Man stahl sogar Steine für andere Bauten.
Zwischen 1740 und 1750 ließ der Amtmann Johann Christoph Ochs nördlich der Burgruine einen Park im
französischen Stil anlegen, der Ende desselben Jahrhunderts im englischen Stil umgestaltet wurde. Die
schönen Anlagen des „Amtsgartens“ zwischen Wiesen, Feldern und anmutigen Höhen zogen viele Dichter
an. Der Dichter Joseph von Eichendorff hatte ein Stück weiter von den Klausbergen aus die beste Sicht auf
die Burg. Dort, wo jetzt ihm zu Ehren eine steinerne Bank steht, fand er die Worte zu seinem verklärenden Gedicht „Bei Halle“.
„Da steht eine Burg überm Tale“ bekam Anfang des 20. Jahrhunderts vom halleschen Komponisten Gerd Ochs eine eingehende
Melodie, wodurch dieses Lied zu einer Hymne meiner Stadt wurde.



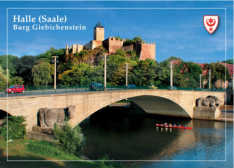





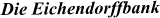
Eichdorffs Aussicht

Freiherr
Joseph von
Eichendorff
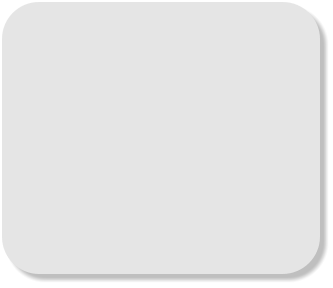
Da steht eine Burg überm Tale und
schaut in den Strom hinein. Das ist die
fröhliche Saale. Das ist der
Giebichenstein.
Da hab ich so oft gestanden. Es blühten
Täler und Höhn. Und seitdem in allen
Landen sah ich nimmer die Welt so
schön!
Durchs Grün da Gesänge schallten, von
Rossen, zu Lust und Streit schauten viel
schlanke Gestalten, gleichwie in der
Ritterzeit.
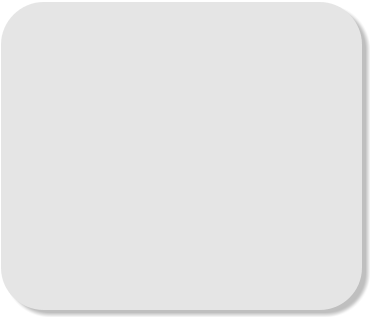
Wir waren die fahrenden Ritter. Eine Burg
war noch jedes Haus. Es schaute durchs
Blumengittermanch schönes Fräulein
heraus.
Das Fräulein ist alt geworden. Und unter
Philistern umher zerstreut ist der
Ritterorden, kennt keiner den andern mehr.
Auf dem verfallenen Schlosse,wie der
Burggeist, halb im Traum, steh ich jetzt
ohne Genossen und kenne die Gegend
kaum.
Und Lieder und Lust und Schmerzen, wie
liegen sie nun so weit –O Jugend, wie tut im
Herzen mir deine Schönheit so leid.