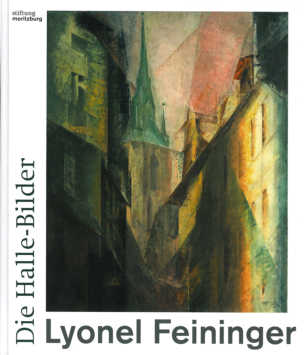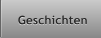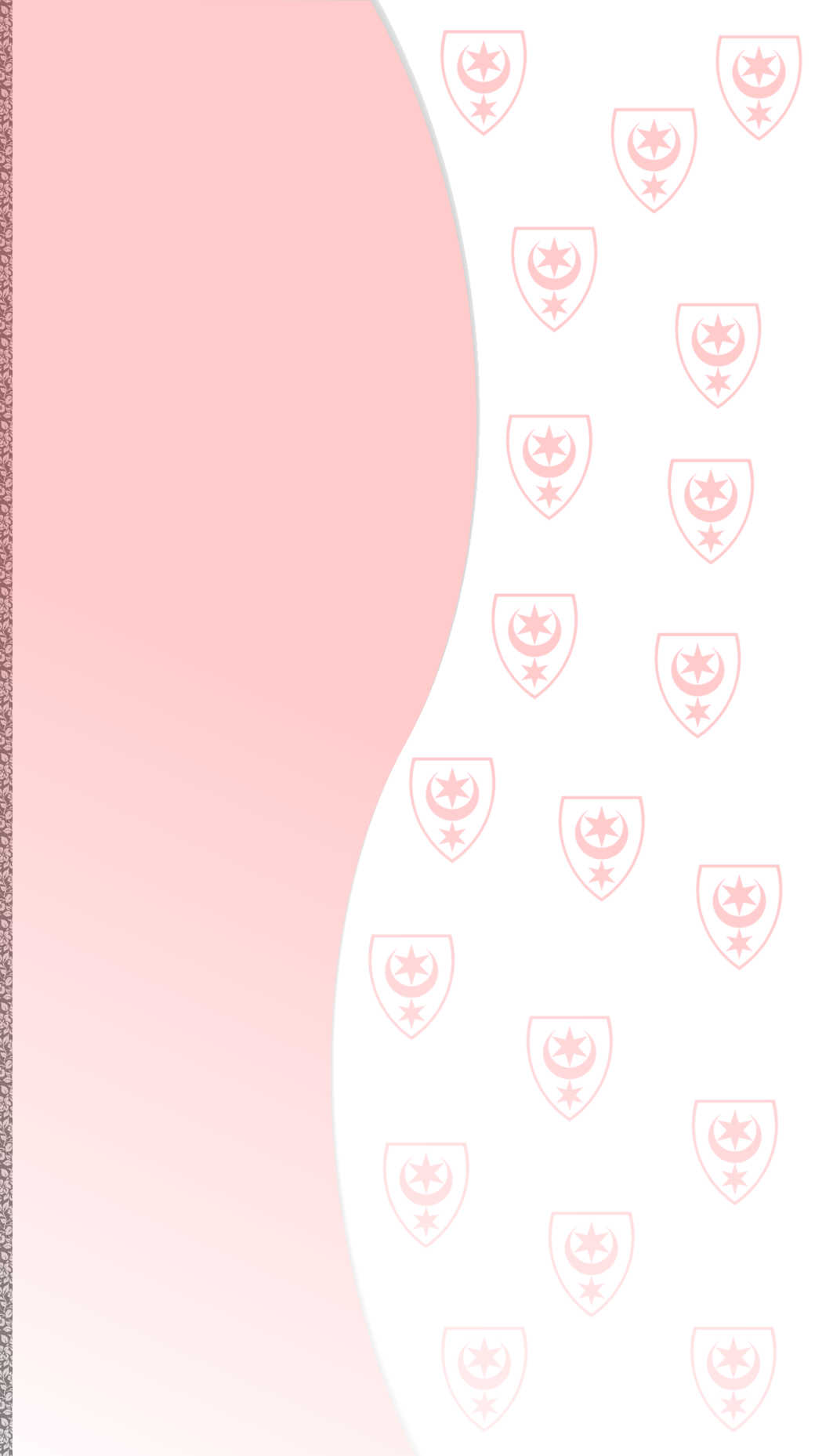

zuletzt aktualisiert 2020



So nah der Moritzburg … da wird doch wieder eine ganz bestimmte Person die Hand im Spiel gehabt
haben … natürlich! Kardinal Albrecht. Wo einst blühende Gärten von den Brüdern des Klosters
Neuwerk bewirtschaftet wurden, ließ Albrecht eine Schanze zum Schutz des nördlichen Bereiches
seiner Moritzburg aufwerfen. Nach einem großen Burgbrand verlor diese an Bedeutung. Es wurde ein
Jagdhaus errichtet. Seitdem nannte man das Gebiet „Jägerberg“. Doch auch das Jagdgebiet hatte nicht
lange Bestand. Eine Textilmanufaktur entstand. 1792 erwarb die Freimaurerloge „Zu den 3 Degen“ das
Gelände. Zwischen 1868 und 1888 wurde der Logenpalast errichtet, den wir heute sehen. Über 100
Jahre wurde das Gebäude für ihre Logentätigkeit genutzt. Nach dem 2. Weltkrieg wurde hier die
Stadtkommandantur der Roten Armee untergebracht, die es vorwiegend als Kulturhaus nutzte.
1952, als die Martin-Luther-Universität das Haus übernahm, wurde es nach dem russischen
Revolutionär Nikolai Gawrilowitsch Tschernyschewski benannt. In der DDR wurden die Säle für
wichtige Veranstaltungen, wie z.B. Jugendweihen genutzt. Ich erinnere mich an eine Auszeichnung
während meiner Lehrzeit. So durfte ich an einem „Teeabend am Samowar“ mit russischen
Komsomolzen teilnehmen. An diesem Abend lernte ich das Haus von innen kennen, aber eine Freude
war es nicht. Ich habe mich zu Tode gelangweilt. Damals hatte ich noch kein Auge für besondere
Architektur, über die geheimnisvollen Freimaurer wusste ich nichts und ein großer Teefreund war ich
noch nie.
2009 wurde das ehemalige Tschernyschewskihaus an die Deutsche Akademie der Naturforscher
Leopoldina übertragen. 3 Jahre später war eine umfangreiche Sanierung nach allen Auflagen des
Denkmalschutzes abgeschlossen. Und so thront jetzt ein wundervolles Gebäude in strahlendem Weiß
über der Moritzburg.
Welche Stadt in Deutschland kann schon auf zwei Burgen innerhalb des Stadtgebietes verweisen?
Halle! Wir haben die Moritzburg und die Burg Giebichenstein. Der kastellartige Bau
der Moritzburg liegt zwischen Friedemann-Bach-Platz und dem Steilufer der Saale.
Halle rang um Autonomie, die Pfänner und Bürgerschaft stritten um die Vorherrschaft
im halleschen Rathaus. Es brodelte. 1478 machte Erzbischof Ernst dem ein Ende
indem er die Pfänner entmachtete und der Stadt die Selbständigkeit nahm. Nicht zum
Schutz der Stadt, als vielmehr zum Zeichen seiner Macht und der genommenen
Freiheit der Bürger ließ er 1484 den Grundstein für eine Burg legen. Sie war dem
fränkischen Schutzheiligen Moritz geweiht und schließlich komplett aus Naturstein
gebaut. 1503 bezog der Erzbischof die Räume und starb 10 Jahre später. Sein
Nachfolger war … na, wer schon? Kardinal Albrecht. Wahrscheinlich gab es da
erstmal ein Aufatmen, denn Albrecht war der Stadt weit freundlicher gesonnen.
Sogleich wurden von ihm zahlreiche Veränderungen vorgenommen. So verlegte er
den Eingang von Norden auf die Ostseite, ließ einen neuen Torturm errichten
und schuf hier nun sein „Neues Stift“ als katholische Bildungsstätte. Auch legte
er mehr Wert auf die Funktion als Verteidigungsanlage. 1637 brach ein großes
Feuer aus, verursacht durch die Fahrlässigkeit sächsischer Soldaten. Somit war
die Burg als Wehranlage unbrauchbar geworden. Mit der Sprengung eines
Turmes, der als Pulvermagazin diente, verwandelten schwedische Militärs die
Burg 1639 ganz und gar in eine Ruine. Etwa 40 Jahre blieb alles unverändert,
bis eine Münzstätte einzog. Nach dem Anschluss Halles an die Kur
Brandenburg gab es auch wieder Soldaten in den alten Mauern. Die französisch
- reformierte Gemeinde nahm später Besitz von der lange leer stehenden
Magdalenenkapelle. Als 1852 die Moritzburg preußischer Staatsbesitz wurde, richtete die Universität
im ehemaligen Fechtsaal eine Turnhalle ein. In der Zeit von 1901 bis 1904 entstand in der
Südwestecke der Burg das 1882 am Hallmarkt abgerissene Talamt neu. Dabei wurde auch
das Hochzeits- und Gerichtszimmer der Halloren zum Teil im Original wieder aufgebaut.
Die gesamte Südhälfte der Moritzburg wurde zum Museumskomplex. Die Galerie
Moritzburg verfügt heute über eine einzigartige Kunstsammlung vor allem
expressionistischer Maler. Lyonel Feininger hatte im Torturm sogar ein eigenes Atelier,
wo seine berühmten Halle–Ansichten entstanden. Nach dem 2. Weltkrieg war die Galerie
Moritzburg eine der ersten Kunstmuseen, die wiedereröffnet wurden. Sie war auch das
Zuhause des bekanntesten Kabaretts der Stadt, „Die Kiebitzensteiner“. Von einer kleinen
Bühne übertrug das DDR-Fernsehen regelmäßige zeitgenössische Stücke mit bekannten
DDR-Schauspielern. Auf dem Burghof fanden im Sommer zahlreiche Konzerte statt. Wies
das Fernsehprogramm am Samstagabend auf die „Burgparty“, bedeutete das, im Burghof
der Moritzburg Halle trafen sich viele internationale Unterhaltungskünstler; und nur ein
kleiner exquisiter Kreis „Normalsterblicher“ kam auf abenteuerliche
Weise zu Eintrittskarten, um der Veranstaltung live beizuwohnen.
Auch heute noch ist die Moritzburg ein Zentrum von Kunst und
Kultur in Halle … nur ist es ein wenig
ruhiger geworden.